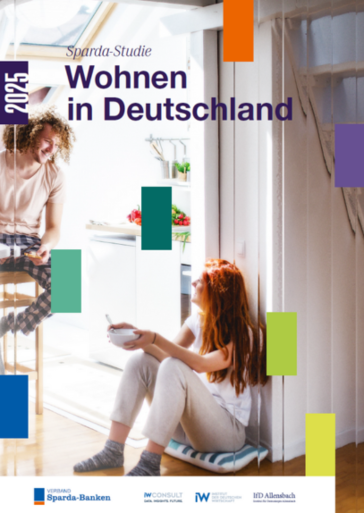Wohnen in Deutschland 2025
Wunsch nach Eigenheim ungebrochen hoch, doch Eigentumsquote sinkt
Erscheinungstermin: Juni 2026
Herausgeber: Verband der Sparda-Banken e.V., Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
Der demografische Wandel, die zunehmende Urbanisierung und die Herausforderungen des Klimawandels verändern nicht nur das gesellschaftliche Zusammenleben, sondern auch die Anforderungen an Wohnraum. Angesichts steigender Mieten, wachsender Nachfrage nach nachhaltigen Gebäuden und veränderter Lebensstile stellt sich die Frage, wie das Wohnen in Deutschland in Zukunft aussehen wird – und was dies für die Immobilienwirtschaft bedeutet. Besonders relevant ist dabei, welche Wohnformen bevorzugt werden, wie sich die Ansprüche an die Wohnumgebung verändern und welche Rolle Eigentum und Miete künftig spielen. Die aktuelle Studie „Wohnen in der Zukunft – Sparda-Wohnstudie 2025“, herausgegeben vom Verband der Sparda-Banken in Zusammenarbeit mit dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW), beleuchtet diese Themen aus wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und immobilienbezogener Perspektive.
Die zentralen Ergebnisse:
Zukunftswunsch: Eigentum im Grünen – Realität: Miete in der Stadt
Trotz der anhaltenden Urbanisierung bevorzugen viele Deutsche laut Umfrage das Leben im eigenen Haus im Grünen. Insbesondere junge Menschen und Familien äußern diesen Wunsch. Die Realität sieht jedoch anders aus: Hohe Preise, knapper Wohnraum und zunehmende Verdichtung führen dazu, dass vor allem in den Städten eher zur Miete gewohnt wird. Daraus ergibt sich ein wachsendes Spannungsfeld zwischen Wunsch und Wirklichkeit, das direkte Auswirkungen auf die Nachfrage und somit auf die strategische Ausrichtung von Projektentwicklern hat.
Wohnkostenbelastung bleibt zentrales Problem
Ein erheblicher Teil der Bevölkerung empfindet die Wohnkostenbelastung als zu hoch – vor allem in Großstädten. Die Studie zeigt, dass rund 45 % der Haushalte mehr als 30 % ihres Nettoeinkommens für Wohnen aufwenden, was als kritisch gilt. Dies wirkt sich auf die Zahlungsbereitschaft für Zusatzangebote im Wohnumfeld aus und verstärkt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Für Investoren bedeutet dies: Projekte mit Fokus auf kosteneffizientes, dennoch qualitätsvolles Wohnen bleiben gefragt.
Homeoffice beeinflusst Wohnstandortpräferenzen
Die Verbreitung von Homeoffice hat die Präferenzen hinsichtlich Wohnort und -form verändert. Arbeitnehmer sind heute eher bereit, längere Pendelzeiten in Kauf zu nehmen, wenn sie nicht täglich ins Büro müssen. Dadurch rücken ländlichere Regionen in den Fokus – insbesondere solche mit guter digitaler Infrastruktur. Dies bietet Potenzial für Neubauprojekte außerhalb der Metropolen, insbesondere in den Umlandregionen großer Städte.
Nachhaltigkeit als entscheidendes Kriterium
Nachhaltigkeit wird beim Wohnen immer wichtiger. Besonders jüngere Zielgruppen legen Wert auf Energieeffizienz, ökologische Baustoffe und nachhaltige Mobilität im Wohnumfeld. Die Zahlungsbereitschaft für entsprechende Angebote steigt, sofern sie transparent und nachvollziehbar kommuniziert werden. Für Bauträger und Bestandshalter ergibt sich hier ein Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb um Nutzer und Investoren.
Kleinere Haushalte, größere Herausforderungen
Der Trend zu Ein- und Zwei-Personen-Haushalten hält an – auch im Alter. Dies führt zu einer gestiegenen Pro-Kopf-Nachfrage nach Wohnraum und erfordert flexible Wohnkonzepte. Gefragt sind kleinere, barrierefreie Wohnungen in gut angebundener Lage, was neue Anforderungen an die Flächenplanung stellt. Auch Shared-Living-Modelle oder modulare Wohnformen gewinnen an Relevanz.
Generationenübergreifendes Wohnen gewinnt an Bedeutung
Neben klassischen Wohnformen steigt das Interesse an gemeinschaftlichen, generationenübergreifenden Wohnprojekten. Besonders in urbanen Lagen zeigt sich eine Offenheit gegenüber innovativen Konzepten wie Co-Housing oder Mehrgenerationenhäusern. Immobilienentwickler können hier soziale Nachhaltigkeit als Mehrwertpositionierung nutzen – auch im Kontext von ESG.
Stadt-Land-Gefälle bleibt bestehen, aber Differenzierung nimmt zu
Während Großstädte mit hohen Preisen und Wohnungsknappheit kämpfen, bieten viele ländliche Regionen Potenzial durch Leerstand und günstigere Rahmenbedingungen. Entscheidend ist jedoch die infrastrukturelle Anbindung. Mittelstädte mit guter Erreichbarkeit und attraktiven Lebensbedingungen gewinnen an Bedeutung – sowohl für Eigennutzer als auch institutionelle Investoren.
Wohnumfeld als entscheidender Faktor
Neben der Wohnung selbst rückt das Wohnumfeld stärker in den Fokus: Grünflächen, Nahversorgung, Mobilitätsangebote und soziale Infrastruktur beeinflussen die Wohnzufriedenheit erheblich. Investitionen in das Quartierumfeld zahlen sich für Projektentwicklungen doppelt aus – durch höhere Attraktivität für Nutzer und bessere ESG-Bewertungen.
Demografischer Wandel erfordert altersgerechtes Wohnen
Die Alterung der Bevölkerung führt zu wachsender Nachfrage nach barrierefreien, altersgerechten Wohnformen. Gleichzeitig möchten viele ältere Menschen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Für die Immobilienwirtschaft bedeutet dies eine langfristige Nachfrage nach Umbauten, Nachverdichtung und neuen Versorgungskonzepten im Quartier.
Wohneigentum bleibt Wunsch, aber kein Selbstläufer
Der Traum vom Eigenheim ist ungebrochen, jedoch durch hohe Baukosten, Zinsen und Eigenkapitalanforderungen für viele unerschwinglich geworden. Nur rund 40 % der Befragten glauben, sich in den nächsten zehn Jahren Wohneigentum leisten zu können. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, neue Modelle wie Baugruppen, genossenschaftliches Eigentum oder geförderten Erwerb stärker zu unterstützen.